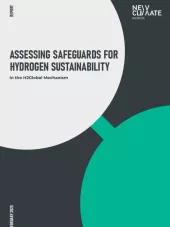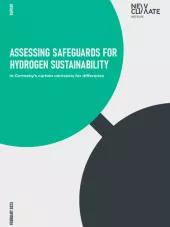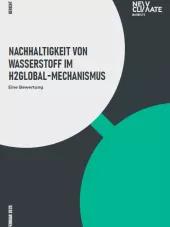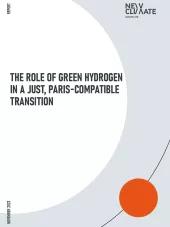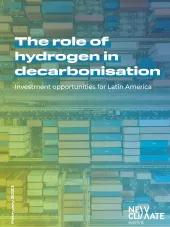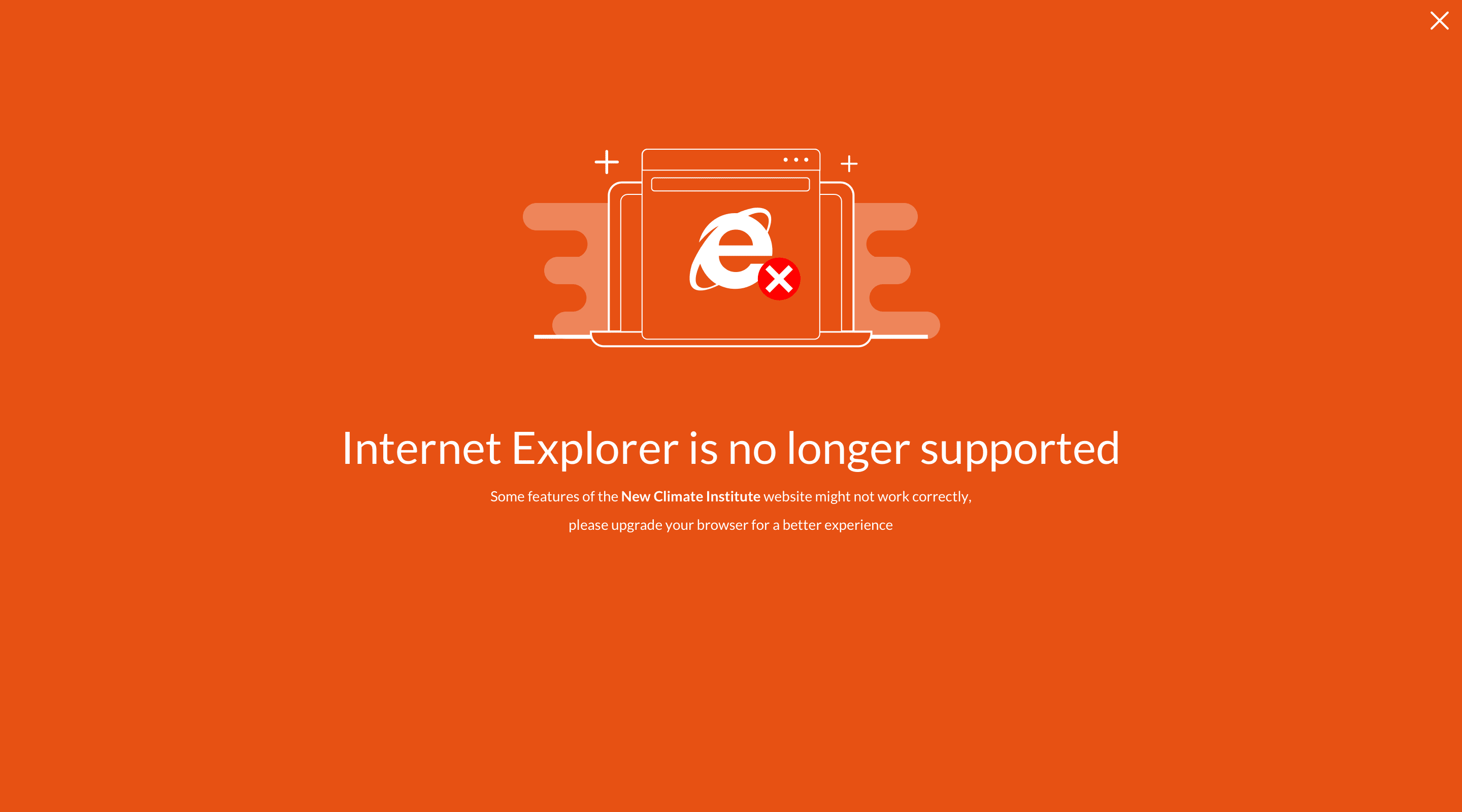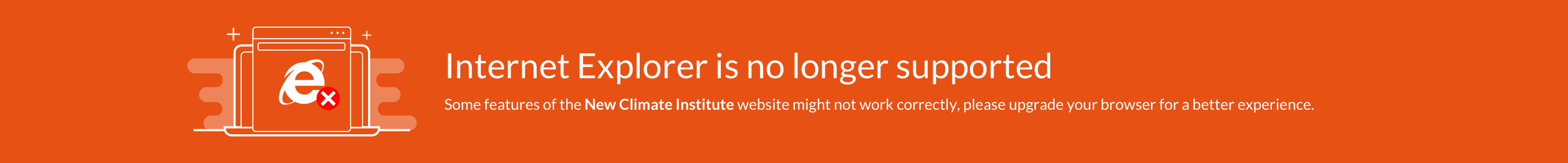Die Bundesrepublik Deutschland hat Wasserstoff als einen wichtigen Hebel für die nationale Dekarbonisierung und die industrielle Transformation identifiziert. Im Jahr 2022 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) das Programm Klimaschutzverträge (KSV) ins Leben gerufen. Die KSV sollen Unternehmen finanziell unterstützen, die eine klimafreundliche Transformation (nicht nur durch Wasserstoff) in energieintensiven Industrien in Deutschland durchführen. Das Instrument bezuschusst die zusätzlichen Kosten für die Umsetzung solcher industrieller Dekarbonisierungsprojekte und hilft damit Deutschland, seine Ziele der Emissionsreduzierung, der industriellen Wettbewerbsfähigkeit und des Wasserstoffhochlaufs zu erreichen.
In dieser Studie wird bewertet, inwieweit das KSV-Instrument so konzipiert ist, dass es die verschiedenen Risiken und Chancen berücksichtigt, die mit der Wasserstoffproduktion und -nutzung verbunden sind – einschließlich der Energie- und Ressourceneffizienz, der Umwelt- und Sozialgarantien und der Auswirkungen auf wasserstoffexportierende Länder.
Diese Studie ist Teil einer zweiteiligen Serie, die Auktionsmechanismen zur Unterstützung der Wasserstoffentwicklung untersucht. Die zweite Studie der Reihe analysiert den H2Global-Mechanismus.
Wichtigste Erkenntnisse
- Förderung von "kohlenstoffarmem" Wasserstoff
Deutschlands Nationale Wasserstoffstrategie (NWS) verbietet eine direkte öffentliche Förderung der Produktion von „kohlenstoffarmem" Wasserstoff und erlaubt nur eine anwendungsseitige Förderung. Die KSV fokussieren sich ausschließlich auf die Nutzung von Wasserstoff in industriellen Projekten und schließen die Wasserstoffproduktion aus der Förderung aus. Dies könnte dennoch im Widerspruch zu den NWS stehen, da die Projekte die Kosten für die Wasserstoffproduktion in ihre Angebotspreise einbeziehen können und somit indirekt Subventionen für die kohlenstoffarme" Wasserstoffproduktion erhalten.
Künftige KSV-Förderrunden sollten ausdrücklich die direkte und indirekte Förderung von fossilem Wasserstoff ausschließen.
- Anreize für grünen Wasserstoff
Grüner Wasserstoff wurde in der ersten Runde der KSV-Förderung bevorzugt aufgrund seiner inhärent niedrigeren Lebenszyklusemissionen und anderer Kostenanreize. In einem überarbeiteten Entwurf der KSV-Förderrichtlinie wird jedoch vorgeschlagen, das Kriterium der Emissionsminderung bei der Angebotsbewertung zu streichen, wodurch der Wettbewerbsvorteil von grünem Wasserstoff gegenüber „kohlenstoffarmem“ Wasserstoff geschmälert würde.
Wir warnen vor dieser Änderung und empfehlen, den Dynamisierungszuschlag und die Preisrisikodeckung für grünen Wasserstoff deutlich zu erhöhen und die Preisrisikodeckung für „kohlenstoffarmen“ Wasserstoff abzuschaffen. Wir empfehlen außerdem, für „kohlenstoffarmen“ Wasserstoff weiterhin eine höhere Mindestschwelle für die Emissionsreduzierung zu verwenden als für grünen Wasserstoff und eine solide Bilanzierung der vorgelagerten Emissionen sicherzustellen, um eine klare Präferenz für grünen Wasserstoff zu signalisieren.
- Energie- und Ressourceneffizienz
Bei der vollständigen Berücksichtigung aller Lebenszyklusemissionen sollte der KSV-Ausschreibungsmechanismus, der Anreize zur Kostenminimierung bietet, ausreichen, um ein möglichst energie- und ressourceneffizientes Ergebnis zu erzielen. Es ist jedoch unklar, ob die Transportemissionen von vorgelagertem Wasserstoff berücksichtigt werden.
Dies könnte dazu führen, dass die Transportemissionen und die damit verbundenen Energieverluste nicht vollständig in den Angebotspreisen berücksichtigt werden.
Wir empfehlen, die Emissionen aus dem Verkehr ausdrücklich zu berücksichtigen, um Anreize für Projekte zu schaffen, bei denen Wasserstoff und seine Derivate so weit wie möglich in der Nähe des Projektstandorts hergestellt werden. In ähnlicher Weise würde der Ausschreibungsmechanismus auch die höheren Kosten ineffizienter Wasserstoffverwendung widerspiegeln, was jedoch nicht garantiert, dass solche Projekte nicht den Zuschlag erhalten. Es ist daher notwendig, zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass Wasserstoff nur in Projekten oder Sektoren eingesetzt wird, in denen eine direkte Elektrifizierung keine praktikable Option ist.
- Höhere Anforderungen an die Nachhaltigkeit
Projekte, die in Europa hergestellten Wasserstoff verwenden, unterliegen automatisch den EU-Umwelt- und Sozialvorschriften. Setzen Projekte jedoch auf von außerhalb der EU importierten Wasserstoff, können sie die Nachweise zur Zertifizierung möglicherweise umgehen.
Deutschland sollte einen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstandard entwickeln, der nicht nur ökologische und soziale Aspekte beinhaltet, sondern auch aktiv die Wertschöpfung für lokale Gemeinschaften in wasserstoffexportierenden Ländern fördert. Die KSV-Förderrichtlinie sollte ausdrücklich vorschreiben, dass alle Arten von Wasserstoff, unabhängig davon, wo sie produziert werden, diesem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstandard entsprechen müssen.
Diese Studie wurde von der Deutschen Umwelthilfe finanziert.